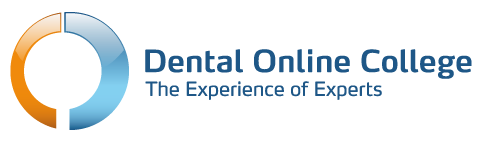Kommunikation ist der Dreh- und Angelpunkt der Kinderzahnmedizin. Ohne ein geeignetes Verhaltensmanagement ist die Behandlung junger Patienten nur schwer möglich. Insofern war es nur folgerichtig, dass die Deutsche Gesellschaft für Kinderzahnmedizin (DGKiZ) Kommunikation zum Schwerpunktthema ihres ersten Hauptkongresstages Mitte Mai 2025 machte. Im Plenarsaal des ehemaligen Bonner Bundestags fand das Thema bei Behandlern und Praxisteams gleichermaßen Gehör.
Das Alter der Kinder, die Involviertheit der Eltern und die Beziehung zwischen Eltern und zu behandelndem Kind sind Faktoren, die eine reflektierte Kommunikation zu einem entscheidenden Werkzeug machen, um eine tragfähige Arzt-Patienten-Beziehung aufzubauen.
Hinzu kommen spezifische Problemlagen bei Kindern und Jugendlichen – etwa Essstörungen –, die angesprochen werden sollten, um den Betroffenen zu helfen. Auch Risikogruppen sollen erreicht werden, damit Prävention, beispielsweise hinsichtlich Karies, erfolgreich ist. So war ein einzelner Kongresstag fast zu kurz, um alle Aspekte jener zentralen Frage von DGKiZ-Präsidentin Prof. Dr. Katrin Bekes zu beantworten: „Was können wir tun, damit Kommunikation gelingt?“
Oft sind es Ängste, die Kinder eine Behandlung verweigern lassen oder zumindest die Kooperation erschweren. Eine aktuelle Metaanalyse ergab, dass rund ein Drittel der jungen Patienten, die in die Praxis kommen, Angst vor der Behandlung haben (Vorschulkinder 36,5 Prozent, Schulkinder 25,8 Prozent, Jugendliche 13,3 Prozent [1]).
Wie sollte man ängstlichen Kindern begegnen? Eine Antwort gab Diplom-Psychologin Dr. Jutta Markgraf-Stiksrud (Gießen). In ihrem Vortrag befasste sie sich mit dem angemessenen Umgang mit Zahnbehandlungsangst ohne Krankheitswert (abzugrenzen von der Phobie nach ICD-10 F93.1).
Einer aktuellen Metaanalyse von Geddis-Regan et al. [2] zufolge wünschen sich Kinder im Rahmen des Behaviour Managements Vertrauen zum Behandlern, vorbereitende Informationen sowie selbst kontrollieren zu können, was geschieht.
Referentin Markgraf-Stiksrud betonte, dass zunächst die individuellen Angstauslöser identifiziert und möglichst vermieden werden sollten, um die subjektiv empfundene Bedrohung zu reduzieren. Ziel müsse es sein, den Kindern zu helfen, mit geeigneten Strategien selbstständig mit ihren Ängsten umzugehen. Eine solche Angstbewältigung erfordert Übung – gelingt sie, sind Kinder auch in der Lage, temporär die Kontrolle über die Behandlungssituation abzugeben.
DGKiZ-Vizepräsidentin Dr. Isabell von Gymnich (Regensburg) nähert sich dem Thema auf andere Weise – wie sie im Interview erläutert. Auf dem Kongress war sie mit einem Teamvortrag vertreten.

Dr. Nicola Meissner (von links), Dr. Jutta Markgraf-Stiksrud und Dr. med. dent. Karolin Höfer gehörten zu den Referentinnen auf der DGKiZ-Jahrestagung.
Erosionen durch Essstörungen — was tun?
Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen nehmen zu. Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts aus dem Jahr 2019 weist rund ein Drittel der Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren Symptome einer Essstörung auf.
Kinderzahnärzte können durch das Erkennen oraler Symptome frühzeitig zur Diagnose beitragen. Dr. med. dent. Karolin Höfer, Oberärztin an der Uniklinik Köln, stellte in ihrem Vortrag geeignete Kommunikationsstrategien vor, um Betroffene und deren Eltern auf mögliche Essstörungen anzusprechen.
Bei den Essstörungen werden Annorexia nervosa, Bulimie und Binge Eating unterschieden; Genaueres ist der aktuellen Leitlinie zu S3-Leitlinie „Diagnostik und Therapie der Essstörungen“ zu entnehmen [3]. Auffälligkeiten in der zahnärztlichen Anamnese und Diagnostik sind unter anderem charakteristische Muster von Zahnhartsubstanzverlust, Parodontalprobleme, Cheilitis angularis, vergrößerte Speicheldrüsen, Xerostomie und Schleimhautveränderungen.
Zahnhartsubstanzverlust betrifft bei Essstörungen mit häufigem Erbrechen palatinale Flächen des Oberkiefers. Glatter, glänzender Zahnschmelz, die Verkürzung der Schneidezähne sowie das Verschwinden der okklusalen Flächen sind ebenfalls als Hinweise auf eine mögliche Essstörung zu werten. Weitere Auffälligkeiten sind unter anderem kleine punktförmige Einblutungen und Verletzungen des Rachens.
Vertrauen, Empathie und Akzeptanz
Höfer empfahl das „Motivational Interviewing“ nach Miller und Rollnick als geeignete Gesprächsstrategie, um mit Betroffenen ins Gespräch zu kommen und gegebenenfalls eine Überweisung in die Kinder- und Jugendpsychologie einzuleiten. Das Konzept ist im sozialen und medizinischen Kontext – auch in der Zahnmedizin – etabliert [4, 5]. Es basiert auf Vertrauen, Empathie und Akzeptanz. Widerstände werden nicht konfrontativ, sondern reflektierend angegangen; Verhaltenshintergründe werden besprochen, Diskrepanzen zwischen Verhalten und Zielvorstellungen sachlich offengelegt. Gesprächstechniken sind zum Beispiel offene Fragen, aktives Zuhören, Reflektieren, Bestärken und Zusammenfassen.
Das Beispiel der Referentin für diese Methode:
- Offene Frage: „Was denkst du selbst, warum sind deine Zähne so empfindlich?“
- Reflexion: „Du sagst, es fällt dir schwer, mit dem Erbrechen aufzuhören – und gleichzeitig machst du dir Sorgen um deine Zähne.“
- Zusammenfassung: „Du bist hin- und hergerissen: Einerseits möchtest du deine Gesundheit schützen, andererseits fühlst du dich im Moment noch nicht bereit, etwas zu verändern.“
- Akzeptanz: „Ich verstehe, dass das schwierig für dich ist.“
Motivation zur Mitarbeit
Zunächst sollte die betroffene Person zur Mitarbeit erreicht werden. Bei mangelnder Einsicht können, erklärt Höfer, auch die Eltern einbezogen werden. Wichtig sei, keine Verdachtsdiagnose zu äußern, sondern die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu betonen.
Bei schwerwiegender Gefährdung kann eine Meldung an das Jugendamt erfolgen – auch ohne Einwilligung der Sorgeberechtigten (Paragraf 8a SGB VIII). Unterstützung bietet in NRW das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen.
Sprachbarrieren überwinden
Sprache ist komplex – um gegenseitiges Verständnis zu erreichen, müssen viele Hürden überwunden werden. Der Abbau der Kommunikationshürde zu Menschen mit Migrationsgeschichte – fremde Sprache und kulturelle Unterschiede – gewinnt an Relevanz angesichts der Ergebnisse der DMS 6, die „Migration“ als einen eigenständigen Risikofaktor für Karieserfahrung identifizierte [6]. So haben ZwölfJährige der ersten Generation mit Migrationsgeschichte durchschnittlich 1,6 Zähne mit Karieserfahrung – dreimal so viele wie der Durchschnitt.
PD Dr. Ghazal Aarabi (Hamburg) erläuterte, dass sich in Gesundheitseinrichtungen neben professionellen Dolmetschenden auch zweisprachige Mitarbeitende als Übersetzer bewähren. Jede zweite Auszubildende in Zahnarztpraxen hat heute eine Migrationsgeschichte – ein großes Potenzial, das im Praxisalltag genutzt werden kann.
Zur Unterstützung der zahnmedizinischen Prävention hat das Team um Aarabi die Zahn-App MuMi zur „Förderung der Mundgesundheitskompetenz und Mundgesundheit von Menschen mit Migrationshintergrund“ entwickelt: ein kultursensibles Informations-, Beratungs- und Schulungsprogramm zu Mundgesundheit, Ernährung und dem Gesundheitssystem in Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch und Russisch. Die App ist über die gängigen App-Stores verfügbar und wird derzeit für Kinder, Jugendliche sowie Schwangere erweitert.
Grundlegendes zur Kommunikation
Wie vielschichtig Sprache ist, wurde im Vortrag von Dr. Nicola Meißner (Berlin) deutlich. Sie stellte ihrem Vortrag zur Teamkommunikation die treffende Frage voran: „Worum geht es euch wirklich?“. Oft sind es verborgene Konflikte auf der Beziehungsebene, die Probleme verursachen. Doch, so Meißner: „Ein gut gelöster Konflikt kann uns weiterbringen!“ Entscheidend sei, Konflikte frühzeitig auf einer Win-Win-Ebene zu lösen (Eskalationsstufen nach Glasl), bevor sie in destruktive Auseinandersetzungen münden.
Führungskräfte haben Schiedsrichterrolle
Führungskräfte müssten dabei eine „Schiedsrichterrolle“ übernehmen. Ziel sei es, empathisch einen für alle tragbaren Ausgleich zu finden. Der Vortrag machte deutlich, wie hilfreich Kommunikationstheorien – etwa das Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun, die Axiome Paul Watzlawicks oder die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg – im sozialen Alltag sein können.
Fazit: Die Vorträge dieses Kongresses haben die Wahrnehmung für Kommunikationsprozesse geschärft und das Interesse an Kommunikationstheorien geweckt – an Methoden, die speziell auf die Bedürfnisse der Kinderzahnarztpraxis zugeschnitten sind, sowie solchen, die sich auch im Alltag als erhellend und hilfreich erweisen.
Dagmar Kromer-Busch, Köln

DGKiZ-Präsidentin Prof. Dr. Katrin Bekes stellte die zentrale Frage des Kongresses vor: „Was können wir tun, damit Kommunikation gelingt?“.
Literatur
[1] Grisolia BM, Dos Santos APP, Dhyppolito IM, Buchanan H, Hill K, Oliveira BH. Prevalence of dental anxiety in children and adolescents globally: A systematic review with meta-analyses. Int J Paediatr Dent. 2021;31(2):168–183. doi:10.1111/ipd.12712
[2] Geddis-Regan A, Fisal ABA, Bird J, Fleischmann I, Mac Giolla Phadraig C. Experiences of dental behaviour support techniques: A qualitative systematic review. Community Dent Oral Epidemiol. 2024;52(5):660–676. doi:10.1111/cdoe.12969
[3] S3-Leitlinie „Diagnostik und Therapie der Essstörungen“, zu entnehmen AWMF Leitlinienregister, AWMF, 2028 (derzeit in Überarbeitung) https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/051–026. Zuletzt eingesehen: 10.06.2025
[4] Kopp SL, Ramseier CA, Ratka-Krüger P, Woelber JP. Motivational Interviewing As an Adjunct to Periodontal Therapy-A Systematic Review. Front Psychol. 2017;8:279. Published 2017 Feb 28. doi:10.3389/fpsyg.2017.00279
[5] Frost H, Campbell P, Maxwell M, et al. Effectiveness of Motivational Interviewing on adult behaviour change in health and social care settings: A systematic review of reviews. PLoS One. 2018;13(10):e0204890. Published 2018 Oct 18. doi:10.1371/journal.pone.0204890
[6] Sechste Deutsche Mundgesundheitsstudie DMS 6 http://www.deutsche-mundgesundheitsstudie.de/