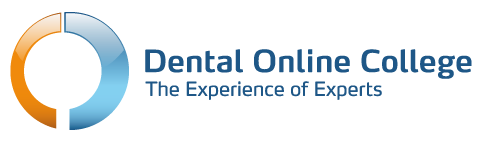Interview: Dr. Isabell von Gymnich, Vizepräsidentin der DGKiZ, über Kommunikation bei der Kinderbehandlung
Zur „Kinderzahnfee“, in die Regensburger Praxis von Dr. Isabell von Gymnich, kommen viele Kinder, die die Behandlung anderswo verweigert haben. Sie und ihr Team sind sehr erfahren im Umgang mit ängstlichen Kindern. Im Interview am Rande des Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnmedizin (DGKiZ) im Mai 2025 befragten wir sie nach ihren Methoden der Kommunikation in der Kinderzahnbehandlung und ihren Erfahrungen. Die Fragen stellte Dagmar Kromer-Busch.
Was brauchen ängstliche Kinder?
Dr. Isabell von Gymnich: Viele Kinder wünschen sich, die Kontrolle zu behalten – und bei uns müssen sie sie nicht abgeben. Wenn ein Kind unsicher oder misstrauisch ist, bekommt es einen großen Handspiegel. Damit kann es genau beobachten, was wir tun. Das ist für uns ein Knackpunkt: Das Kind soll die Möglichkeit haben, jeden einzelnen Schritt mitzuverfolgen. Ob es das dann tatsächlich macht oder lieber Fernsehen am Deckenmonitor schaut, ist egal – wir haben nichts zu verbergen. Viele Kinder lassen sich darauf ein. Sie sind neugierig, weil sie so etwas vorher noch nie erlebt haben.
Wenn ein Kind große Angst vor einer Versiegelung oder einer Füllung hat, setzen wir unsere „Praxistiere“ ein – Handpuppen mit Plastikzähnen. Dann machen wir zum Beispiel bei einem Löwen einfach mal eine Versiegelung. Das Kind assistiert dabei. Das dauert nur zwei Minuten – und das Kind sieht Schritt für Schritt, was passiert. Und: Was man kennt, macht weniger Angst. Das ist eigentlich der ganze Trick. Kinder brauchen Offenheit und Information.
Was in dem Kind vorgeht, ist also nicht das Entscheidende?
Von Gymnich: Wir arbeiten nicht mit einer Angstskala oder etwas Vergleichbarem. Wir behandeln so, dass es keinen Punkt gibt, an dem wir Kindern sagen müssten: „Jetzt wird es schlimm!“. Stattdessen erklären wir vorher genau, was bei der Behandlung eigentlich passiert: Wir zeigen am Zeigefinger des Kindes, wie sich etwas anfühlen wird, dann probieren wir es am Zahn aus. Und der Finger kann es vorher schon an den Zahn funken. Das ist ein Kommunikationstrick.
Kinder akzeptieren das. Sie sagen dann: „Klar, die haben ja WLAN!“ Und wenn der Zahn eine Pause braucht, funkt er zurück an den Finger. Das heißt: Das Kind muss sich nicht auf Angst oder Schmerz fokussieren, muss nicht die Hand heben, wenn es weh tut – sondern wir vertrauen auf das System des Kindes. Das Unterbewusstsein ist ein sehr guter Wächter.
Die Kinder machen oft ganz kleine Bewegungen mit dem Finger, wenn sie eine Pause brauchen – und diese Mikrobewegungen sehe ich und reagiere darauf. Ich muss also sehr genau beobachten, sehr aufmerksam sein und ständig wahrnehmen, was im Kind vor sich geht. Man muss für diese Arbeit wirklich präsent sein.
Lassen sich damit alle Kinder behandeln, die zu Ihnen kommen?
Von Gymnich: Ja, in den meisten Fällen. Wir setzen auch Lachgas ein, um Ängste zu reduzieren. Einen großen Teil der Kinder, die uns zur Behandlung unter Vollnarkose überwiesen werden, können wir in der normalen Praxis mit unseren Methoden behandeln – wenn wir von Anfang an die richtigen Worte wählen. Denn es gibt bestimmte Trigger.
Wenn man etwa sagt: „Es ist gar nicht schlimm“ oder „Du brauchst keine Angst zu haben“, denken viele Kinder sofort: „Wieso sagt sie das? Vielleicht wird es doch schlimm?“ Deshalb vermeiden wir solche Formulierungen. Wir sagen stattdessen: „Es ist spannend“, „Du wirst etwas lernen“, oder „Es ist wie bei ‚Willi wills wissen‘ – schau einfach mal, wie es dir gefällt.“ Wir lenken den Fokus so auf etwas Positives.
Ist Kommunikation in der Kinderzahnmedizin ein zentrales Thema?
Von Gymnich: Ja, auf jeden Fall. Die Art der Kommunikation, die wir mit Kindern anwenden, lernen wir schon in der Ausbildung – also positive Sprache, hypnotische Sprachmuster, das Kind dort abholen, wo es gerade steht. Was aber oft vergessen wird: Die Eltern sind die „verdeckten Hauptpersonen“, denn sie bringen das Kind in die Praxis.
Konzepte, bei denen sich das gesamte Team nur auf das Kind konzentriert und die Eltern eher eine Nebenrolle spielen, funktionieren nur, wenn die Eltern selbst ruhig und strukturiert sind. Wenn sie aufgeregt sind oder eigene schlechte Erfahrungen mitbringen, können sie den gesamten Behandlungserfolg gefährden, wenn sie ihre Sorge nicht loswerden konnten. Deshalb ist es wichtig, das vor der Behandlung zu erkennen, aufzunehmen, anzusprechen und beizulegen.
Heute ist ein gemeinsamer Kongresstag für Behandelnde und Team. Dem Team kommt in der kinderzahnmedizinischen Behandlung eine wichtige Rolle zu. Wie sieht Teamwork bei Ihnen aus?
Von Gymnich: Das Team ist bei uns von Anfang an eingebunden – schon beim Abholen des Kindes aus dem Wartezimmer. Da wird gleich ein erster positiver Kontakt mit dem Kind geknüpft. Die Mitarbeitenden sammeln Informationen und geben sie an mich weiter. Zum Beispiel, wie das Kind drauf ist: Ist das Kind eher schüchtern? Hat es schon Tränchen in den Augen? Oder ist es ganz unbefangen und springt sofort auf den Behandlungsstuhl?
Während der Behandlung ist das Team ebenfalls stark gefordert. Man muss lernen, auf zwei Ebenen gleichzeitig zu arbeiten: Einerseits assistieren, andererseits das sogenannte Verhaltensmanagement oder Behaviourmanagement durchführen, also Geschichten erzählen, erklären und beruhigen. Anfangs wechseln die Mitarbeitenden noch zwischen diesen Ebenen: Entweder sie assistieren oder sie sprechen mit dem Kind.
Mit der Zeit entwickelt sich aber eine Routine, bei der beides parallel möglich ist. Dann können sie schnell und präzise arbeiten und gleichzeitig eine „Quatschgeschichte“ erzählen oder etwas erklären.

Dr. Isabell von Gymnich, Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde (DGKiZ); niedergelassen in eigener Praxis „Kinderzahnfee“ für Kinderzahnmedizin in Regensburg. Auf dem Kongress der DGKiZ hielt sie den Vortrag „Das kleine Einmaleins der Kommunikation – Basics und praktische Anwendungen“.