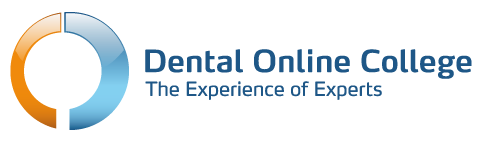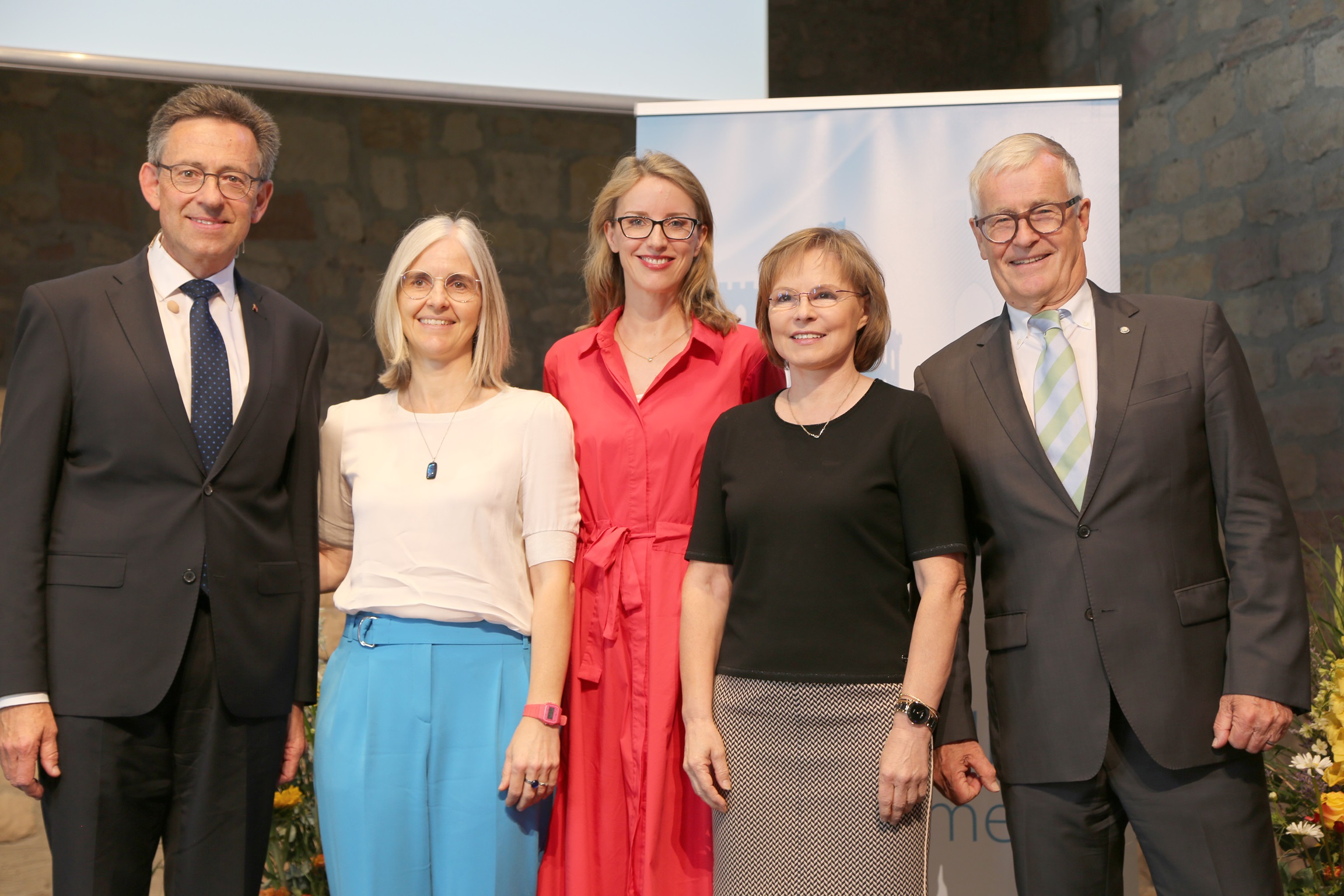Der Kommentar von Chefredakteur Marc Oliver Pick
Mit Problemen wurde sicher schon gerechnet, als vor mehr als 20 Jahren die Idee entstand, die Digitalisierung des Gesundheitssystems in Deutschland mit einer elektronischen Patientenakte (ePA) zu krönen. 2011 wurden aus der Idee handfeste regionale Modellversuche. Knapp anderthalb Jahrzehnte später sind wir immer noch beim Modellversuch. Aktuell läuft die Pilotphase, die unter Beteiligung von 300 Apotheken, Arzt- und Zahnarztpraxen unter Realbedingungen, sprich Versorgungsalltag, durchgeführt wird.
Bundesweites Rollout der ePA verschoben
Offensichtlich traut man im Bundesgesundheitsministerium den eigenen Vorhersagen zum Start des bundesweiten Rollouts nur wenig, denn von der für Mitte Februar angekündigten „epA für alle“ im wortwörtlichen Sinne hat man sich mittlerweile verabschiedet. Jetzt ist vorsichtig die Rede davon, gegebenenfalls doch erst gegen Ende des ersten Quartals oder gar noch später im Laufe des Jahres deutschlandweit starten zu wollen (oder zu können).
In der Zwischenzeit wird allerdings nur zu deutlich, wie wenig ernst die Bedenken und Sorgen weiter Teile der 74 Millionen gesetzlich Versicherten von politisch Verantwortlichen genommen werden, die sich um die Pläne der Monetarisierung ihrer höchst sensiblen Daten Gedanken machen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte bereits berichtet, Konzerne wie Google, Meta und Open AI seien an Gesundheitsdaten aus Deutschland zur kommerziellen Auswertung sehr interessiert – gegen Bezahlung selbstverständlich. Tatsächlich ist bislang lediglich vorgesehen, Daten für Forschungszwecke herauszugeben, allerdings ebenfalls gegen Bezahlung durch die, die damit forschen wollen.
Merz: Vergünstigung für Verzicht auf Opt-out-Recht
Ums Geld ging es auch bei einer Äußerung des CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. In einem Interview mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ sagte er mit Blick auf die ePA, er fände es klug, wenn den Menschen ein ökonomischer Anreiz gegeben würde, das Gesundheitssystem effizienter zu nutzen. Er brachte die Idee ins Spiel, all diejenigen Versicherten, die ihre Datenschutzbedenken zurückstellten und die ePA vollumfänglich und kontinuierlich nutzten, mit einem um 10 Prozent reduzierten Krankenversicherungsbeitrag zu belohnen.
Mit anderen Worten: Datenspende gegen Vergünstigung. Oder andersherum: Skeptiker und datenschutz-sensible Versicherte, die von ihrem gesetzlich garantierten Opt-out-Recht Gebrauch machen, werden sanktioniert, indem sie den üblichen Versicherungsbetrag bezahlen sollen.
Es ist bis heute weder gelungen, den Nutzen der ePA für das Gesundheitswesen und den Einzelnen verständlich zu kommunizieren und transparent zu machen, noch konnten die berechtigten Zweifel an Datenschutz und Datensicherheit auf dem Stand heutiger Technik ausgeräumt werden. Damit wurde der Start eines im Kern sinnvollen digitalen Werkzeugs in der öffentlichen Wahrnehmung unverständlicherweise verstolpert. Dass man nun auf die Idee kommt, ein ökonomischer Anreiz müsse her, um die Bedenken vieler Versicherter zur Nutzung der ePA zu zerstreuen und eine breite Inanspruchnahme zu erreichen, wäre ein Armutszeugnis.
Idee eines ökonomischen Anreizes führt in ökonomisches Desaster
Hinzu kommt: Die seltsame Idee eines ökonomischen Anreizes führt in ein ökonomisches Desaster. Denn woher sollen die Mittel kommen, um den zehnprozentigen Digital-Rabatt gegenzufinanzieren? Angenommen, die Hälfte aller GKV-Versicherten würde alle Bedenken über Bord werfen und der ePA-Nutzung vollumfänglich zustimmen, würden in den Kassen der Kassen laut GKV-Spitzenverband Einnahmen von jährlich 15 Milliarden Euro fehlen.
Ob der zu erwartende Nutzen der ePA hinsichtlich Effizienzsteigerung und daraus resultierenden Einsparungen den entsprechenden Gegenwert liefert, ist fraglich. Sollte das nicht der Fall sein, müsste man am Ende doch mit Google und Co über Geld sprechen, in anderen Worten genau das Gegenteil von dem tun, was von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eigentlich ausgeschlossen sein soll. Dann doch besser echten Nutzen stiften.