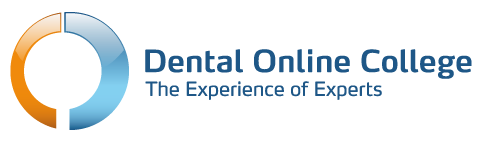Anlässlich der Vorstellung der Sechsten Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS 6) am 17. März in Berlin sprach Dagmar Kromer-Busch mit Prof. Dr. Rainer Jordan über erwartete und unerwartete Ergebnisse der Studie.
Herr Professor Jordan, haben Sie die Ergebnisse der DMS 6 in dieser Form erwartet oder gab es überraschende Entwicklungen?
Prof. Dr. Rainer Jordan: Teilweise haben wir diese Ergebnisse erwartet. Basierend auf den Daten der DMS 5 haben wir Prognosestudien bis 2030 erstellt. Nun können wir überprüfen, wie genau unsere Vorhersagen waren. Insofern hatte ich eine gewisse Vorstellung davon, was uns erwarten könnte. Was mich überrascht hat, ist die Deutlichkeit, mit der sich die Wirksamkeit der Prophylaxe aus der Kindheit der heutigen Erwachsenen zeigt. Besonders auffällig ist der Rückgang der Füllungen – ein Hinweis darauf, dass Karies in vielen Fällen verhindert werden konnte. Es gibt einen Rückgang der Karieserfahrung um 50 Prozent. Das hätte ich so nicht erwartet!
Auch die weitere Reduktion der absoluten Zahnlosigkeit bei Seniorinnen und Senioren hat mich erstaunt. Der Anteil liegt jetzt nur noch bei 5 Prozent Zahnlosigkeit in dieser Gruppe. Bereits in der vorigen Erhebung hatte sich die Zahnlosigkeit halbiert, und damals vermuteten wir einen Zusammenhang mit der Umstellung auf Festzuschüsse, die die prothetische Versorgung für gesetzlich Versicherte verändert hat. Doch diesmal gab es keinen vergleichbaren Einschnitt, und trotzdem hat sich die Zahnlosigkeit erneut halbiert. Daher zeigt sich hier wohl ein genereller Trend in der Zahnmedizin zu mehr Zahnerhalt als auch verbesserte technologische Möglichkeiten hierzu.
Die Prävalenz für Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation liegt in der DMS 6 bei 15,3 Prozent. Können Sie aufschlüsseln, wo die Schwerpunkte der Krankheitsformen der MIH liegen?
Jordan: Der mit Abstand häufigste Befund sind Opazitäten, also Flecken auf dem Zahnschmelz. Allerdings sagt der Schweregrad der MIH nicht zwangsläufig etwas über das Leidensniveau der Patientinnen und Patienten aus. Auch bei reinen Opazitäten können die Zähne empfindlich sein, sodass Kinder Schwierigkeiten haben, sich die Zähne zu putzen. Relativ häufig beobachten wir zudem atypische Restaurationen, aber nur einen geringen Anteil an Zahnverlusten durch MIH. Manche Zähne sind bereits beim Durchbruch so stark betroffen, dass sie nicht erhalten werden können.
Welche Konsequenzen sollten Ihrer Meinung nach aus den Ergebnissen der DMS 6 für die zahnmedizinische Versorgung gezogen werden?
Jordan: Ich glaube, dass wichtig ist, dass sich für MIH ein klares Therapiekonzept durchsetzt. Diese Erkrankung wurde erst um die Jahrtausendwende ausführlicher beschrieben. Für viele niedergelassene Zahnärztinnen und Zahnärzte ist es daher noch nicht ganz klar, wie die einzelnen Stadien der MIH bestmöglich zu behandeln sind.
Im Bereich Karies wurden bestimmte Risikogruppen identifiziert – insbesondere Patienten mit Migrationshintergrund sowie Patienten aus der niedrigen Bildungsgruppe. Diese Gruppen sollten gezielter angesprochen werden. Die allgemeine Prävention in Kindergärten und Schulen ist bereits gut etabliert, dennoch bleibt eine Gruppe von über 20 Prozent der Kinder, die wir nicht erreichen. Moderne Präventionskonzepte sehen vor, direkt in die Communities zu gehen, wo diese Menschen leben und Multiplikatoren für die Aufklärung zu nutzen. Dies kann zahnmedizinisches Personal sein, die die notwendigen Sprach- und kulturellen Kenntnisse mitbringen.
Sie sagen, dass diese Risikogruppen neu identifiziert wurden?
Jordan: Ja, das ist korrekt. Der Migrationshintergrund hat sich als eigenständiger Risikofaktor herausgestellt. Zunächst ging man davon aus, dass Migration lediglich ein Vermittler für den Bildungsstand sei und die Bildung der eigentliche Einflussfaktor ist. Doch selbst wenn man den Bildungsstatus herausrechnet, bleibt Migration ein signifikanter Risikofaktor für eine schlechtere Mundgesundheit.
In der DMS 6 haben Sie eine längsschnittliche Betrachtung einbezogen. Das ist sicherlich mit erheblichem Aufwand verbunden. Weshalb nehmen Sie diesen in Kauf?
Jordan: Wir werden oft gefragt: Warum geht die Karies zurück? Warum steigt die Parodontitis? Solche kausalen Fragen lassen sich wissenschaftlich nur sinnvoll beantworten, wenn man zwei Messzeitpunkte hat, um entsprechend mögliche Ursache und Wirkung zu bestimmen. Deshalb haben wir das Studiendesign entsprechend angepasst und nicht nur neue Probandinnen und Probanden untersucht, sondern auch frühere Teilnehmende nach acht Jahren erneut erfasst; auch wenn es sehr aufwendig war, Probandinnen und Probanden nach zehn Jahren wiederzufinden. Besonders bei den ehemals Zwölfjährigen, die jetzt inzwischen 18 bis 20 Jahre alt sind, war es schwierig, da viele in dieser Lebensphase das Elternhaus verlassen und umziehen.
Titelbild: KZBV/Nürnberger