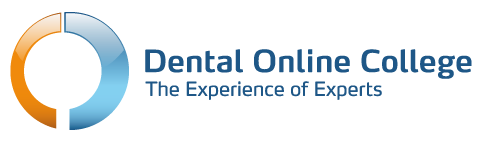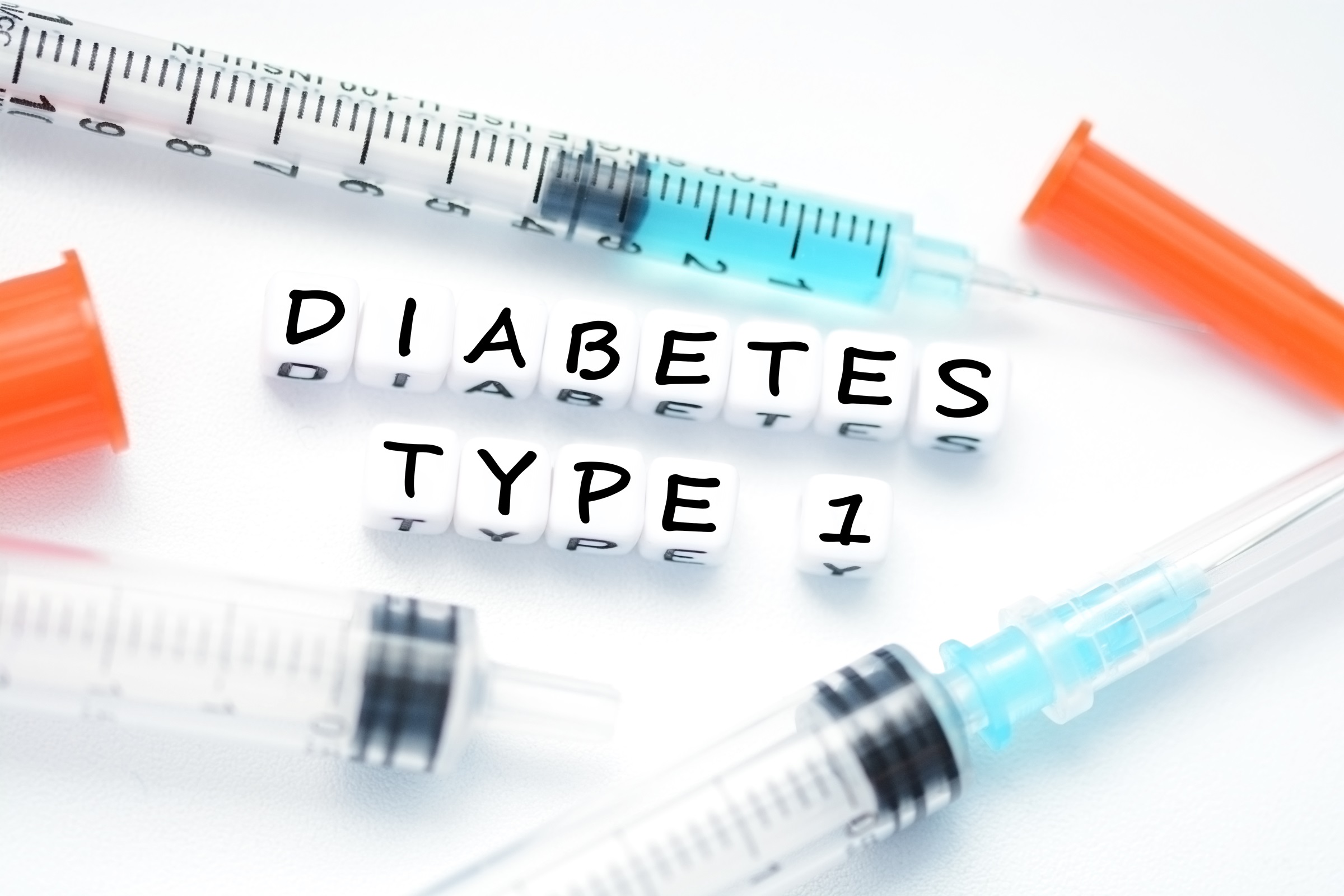Dialyse und Mundgesundheit: Auswirkungen einer gestärten Balance zwischen extra- und intrazellulärem Flüssigkeitsvolumen (Teil 1)
Eine gute Nierenfunktion ist Voraussetzung für einen geregelten Wasserhaushalt und für die Entgiftung unseres Körpers. Eine Störung der Homöostase der Elektrolyte und damit der Balance zwischen extra- und intrazellulärem Flüssigkeitsvolumen, sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts hat negative Auswirkungen auf nahezu alle Organe des Körpers.
Chronische Nierenerkrankungen mit Reduktion der glomerulären Filtrationsrate (GFR) sind leider nicht selten. Sie betreffen etwa 10 Prozent der Erwachsenen weltweit und führen unbehandelt zu Nierenversagen (ESRD: end stage renal disease) und damit zur Notwendigkeit einer Dialyse oder Nierentransplantation.
Zwischen systemischen Krankheiten und Entzündungen wie Gingivitis, Parodontitis und Stomatitis bestehen bekanntlich zahlreiche Wechselwirkungen. So sind auch Funktionsstörungen der Nieren ein unabhängiger Risikofaktor für die Genese und Progression unterschiedlicher oraler Läsionen. Die Beziehung zwischen renaler Insuffizienz und Mundhöhlenerkrankungen wird durch die mit reduzierter Nierenleistung assoziierten Komorbiditäten wie Diabetes mellitus II, kardiovaskuläre Krankheiten oder Lupus erythematodes zusätzlich verstärkt.
Xerostomie und Parodontitis — Folgen mangelnder Entgiftung
Mit fortschreitendem Verlust der eigenen Nierenfunktion steigt die Prävalenz zu oralen Inflammationen; es kommt vermehrt zu Exazerbationen und zu rascher Progression parodontaler Entzündungen. Die Ursache ist ein Zusammenspiel unterschiedlicher krankheitsassoziierter Parameter. Mehr als 50 Prozent aller Dialysepatienten leiden unter ausgeprägter Xerostomie. Vor allem bei Patienten mit Restfunktion der eigenen Niere wird eine adjuvante Therapie mit Diuretika zur Vermeidung einer Volumenüberlastung notwendig.
Eine unerwünschte Nebenwirkung ist häufig verminderte Speichelbildung und Sekretion. Die Spülfunktion der Mukosa und der Zahnoberflächen wird reduziert, es kommt zu einer Erhöhung des pH-Werts in der Mundhöhle und zu einer Verminderung antibakterieller und antifungaler Faktoren wie Lysozym, Laktoperoxidase, Laktoferrin, Histatin und IgA.
Gefahr der Malnutrition bei oralen Läsionen
Begünstigt durch die bei Nierenerkrankungen geschwächte Immunabwehr, verändert sich die Zusammensetzung des oralen Mikrobioms mit einer überproportionalen Vermehrung potenziell pathogener Erreger. Bei Dialysepatienten besteht zudem Gefahr einer Malnutrition mit Etablierung einer katabolen Stoffwechsellage und manifestem Eiweißmangel. Durch die Dialyse werden dem Körper Vitamine, Mineralstoffe und Proteine entzogen, was durch normale Ernährung oft nur schwer auszugleichen ist.
Durch die krankheitsbedingten Geschmacksstörungen leiden die Patienten oft unter Appetitlosigkeit. Wegen der Mundtrockenheit kommt es oft zu einem Burning-Mouth-Syndrom und zu Schluckstörungen. Daher werden weiche, kohlenhydratreiche Nahrungsmittel bevorzugt, was der Fehl- und Mangelernährung Vorschub leistet. Die Mundschleimhaut atrophiert und wird durch den mangelnden Speichelfilm vulnerabel.
Das Kauen harter Speisen führt zu Mikroverletzungen und Blutungen, welche wiederum einen Nährboden für aggressive Erreger darstellen. Im Blut persistierende Metaboliten und Giftstoffe fördern das Entstehen einer urämischen Stomatitis. Die persönliche Mundhygiene ist auf Grund der schmerzhaften Erosionen und Ulzera eingeschränkt und auch regelmäßige Zahnarztbesuche werden vernachlässigt.
Bakteriämie mit oralen Erregern gefährdet Dialysepatienten
Durch die verminderte Erythropoetinproduktion der Niere kommt es zu einer renalen Anämie und dadurch auch zu einer Mangelversorgung der Gingiva und des Alveolarknochens.
Gleichzeitig ist durch den Albuminmangel die Produktion von Immunglobulinen und die Funktion der Granulzyten und Makrophagen eingeschränkt. Die dadurch bedingte Zunahme anaerober und fakultativ anaerober virulenter Bakterien in Kombination mit einer fehlregulierten Abwehrreaktion führt zu massiven Entzündungen mit raschem Attachmentverlust. Der Level an Entzündungsmediatoren wie CRP, IL-8 und IL-6 steigt sowohl im Sulkusfluid als auch systemisch im Serum an.
Mit der Progression der Nierenerkrankung verschlechtert sich der parodontale Status, der dann wiederum negativ auf die Nierenfunktion zurückwirkt. Aus dem geschädigten gingivalen Gewebe werden laufend Erreger in die Blutgefäße eingeschwemmt, die Folge sind rezidivierende Bakteriämien. Besonders bei der Peritonealdialyse stellen chronische Entzündungen wie eine floride Parodontitis eine erhebliche Gefahr für die betroffenen Patienten dar.
Studien zeigten einen signifikanten Zusammenhang zwischen Peritonitis und schlechten oralen Konditionen. So können neben den typischen Parodontitiskeimen auch orale Streptokokken schwere Infektionen hervorrufen. Wegen des erhöhten Bakteriämierisikos bei oralchirurgischen Eingriffen ist deshalb eine prophylaktische Antibiotikagabe eine Stunde vor dem geplanten Eingriff zur Sicherheit der betroffenen Patienten zu empfehlen.
DDr. Christa Eder, Wien
(wird fortgesetzt)
Titelbild: Histock – stock.adobe.com
DDr. Christa Eder
ist Fachärztin für Pathologie und Mikrobiologin. Seit vielen Jahren schreibt sie für das österreichische Fachmagazin „Zahn.Medizin.Technik“ und die deutsche Fachzeitung „dzw – Die ZahnarztWoche“. Auch ist sie als Vortragende im Bereich der zahnärztlichen Mikrobiologie international bekannt.