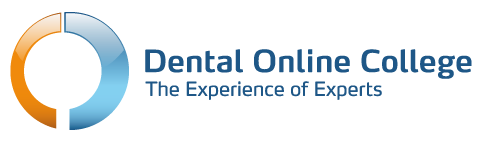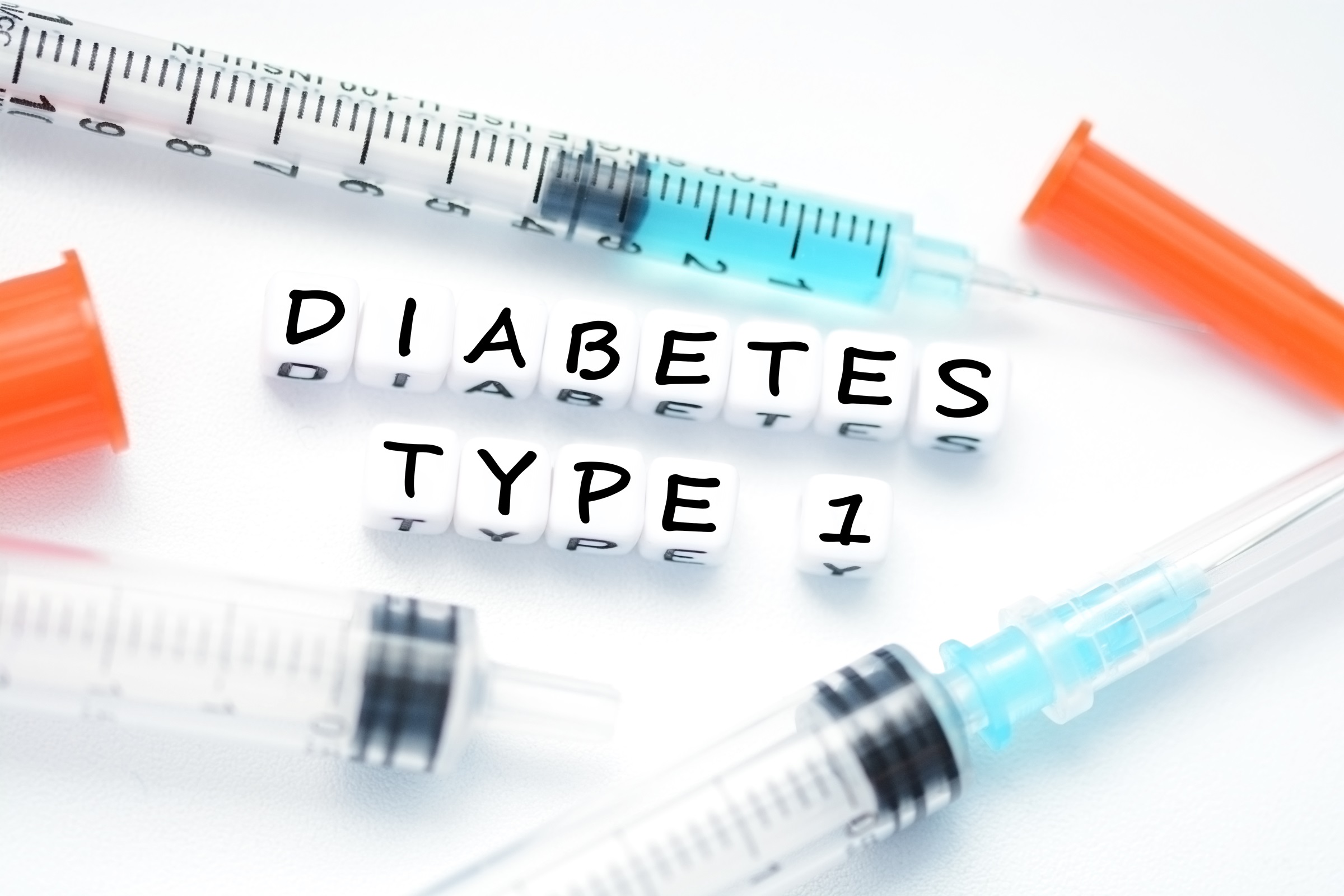Häusliche Mundhygiene als Herausforderung während der unterstützenden Parodontitistherapie (UPT) und der Einfluss einer antientzündlichen Zahnpasta und Mundspülung
Die systematische Parodontalbehandlung ist in der Zahnarztpraxis nach wie vor auf lange Sicht eine Herausforderung für Patienten und Behandler. Der Erfolg der Therapie steht oder fällt nicht nur mit der antiinfektiösen Therapie (AIT), sondern bereits im Vorfeld müssen die Weichen für einen langfristigen Erfolg gestellt werden. Wenn es Patienten nicht gelingt, mittels Aufklärungs- und Therapiegespräch (ATG) und gezielten patientenindividuellen Mundhygieneunterweisungen (MHU) eine Adhärenz zu erreichen, sollten in den folgenden unterstützenden Parodontitistherapien (UPTs) diese bestehenden Lücken geschlossen werden.
Gesamter Verlauf einer Parodontalbehandlung
Der Fallbericht von Dentalhygienikerin Petra Natter, BA, beschreibt den gesamten Verlauf einer Parodontalbehandlung von Februar 2023 bis März 2025. Eine zentrale Rolle spielte die Verbesserung des häuslichen Biofilmmanagements, um den gewünschten Therapiefortschritt dauerhaft zu erzielen. Im Behandlungsverlauf zeigte die Umstellung der Zahnpasta dabei einen positiven Effekt.
Anamnese: Der männliche Patient zwischen 50 und 60 Jahren stellte sich Ende 2022 aufgrund von Schmerzen in der Zahnarztpraxis vor. Wegen eines „Zahnarzttraumas“, wie er es bezeichnete, hatte er bereits einige Jahre keine Zahnarztpraxis besucht, auch nicht zur Professionellen Zahnreinigung (PZR). Der Patient gab an, berufsbedingt montags bis donnerstags viel unterwegs zu sein. Seit 2017 bestand der Verdacht auf einen erhöhten Blutzuckerspiegel, welchen der Patient über eine Ernährungsberatung in den Griff bekommen wollte.
Zu Beginn der Parodontaltherapie (PAR-Therapie) 2023 war der HbA1c-Wert mit 6,8 deutlich erhöht, obwohl der Patient seit Jahren in der Beratung zur Ernährungslenkung war. Das Körpergewicht des Patienten war moderat zu hoch und er gab an, eher beratungsresistent bezüglich seiner Ernährung zu sein. Seit sechs Monaten nahm er Medikamente zur Behandlung seines Bluthochdrucks. Außerdem gab er in der Anamnese eine Penicillinallergie an.
Befund und Behandlungsbeginn
Der schmerzende Zahn 15 musste nach einer erfolglosen Wurzelbehandlung extrahiert werden (Abbildung 1). In der anschließend erfolgten zahnärztlichen Untersuchung wurde eine Parodontalerkrankung nach dem parodontalen Screening-Index (PSI) Code 3 festgestellt.
Der Patient wurde über den Ablauf der nötigen Parodontalbehandlung aufgeklärt und auf den möglichen positiven Einfluss auf sein metabolisches Syndrom und die erhöhten Blutzuckerwerte hingewiesen [1].
Der Patient willigte in eine systematische Parodontalbehandlung ein. Es wurde eine PZR zum Einstieg empfohlen, wobei der Patient die Putztechnik mit der elektrischen Zahnbürste lernte und die Interdentalraumreinigung geübt wurde. Diese Mundhygieneunterweisungen wurden begleitet von Empfehlungen für die geeignete Zahnpasta (für empfindliche Zahnhälse) durch eine Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin (ZMP).
Die oralen Befunde waren 95 Prozent Approximalraum-Plaque-Index (API) und 84 Prozent Bleeding on Probing (BOP) (Abbildung 10). Das Zahnfleisch war zu diesem Zeitpunkt sehr entzündet, es zeigten sich viele Konkremente (Abbildung 2). Es wurde eine professionelle Zahnreinigung beziehungsweise professionelle mechanische Plaquereduktion (PMPR) nach den S3-Leitlinien durchgeführt.
Der Antrag an die gesetzliche Krankenkasse (GKV) mit der Diagnose Parodontitis Stadium II Grad B und die Genehmigung für die Behandlung erfolgten umgehend im Februar 2023. Die antiinfektiöse Therapie wurde im April 2023 von einer Dentalhygienikerin systematisch in einer Sitzung durchgeführt.
Befundevaluation nach erfolgter AIT
Die Termine für die Befundevaluation (BEV) und die unterstützende Parodontaltherapie wurden nach fünf Monaten fixiert. Der Zahnfleischzustand und die häusliche Mundhygiene des Patienten sowie die Blutungen waren nicht ideal, aber deutlich besser: Der API lag im September 2023 bei 100 Prozent durch mangelnde Interdentalraumreinigung, der BOP bei 29 Prozent und war damit schon viel besser ( Abbildung 11). Der Patient wurde noch einmal in der Interdentalraumreinigung instruiert.
Die zweite UPT mit verbessertem API 50 Prozent und 16 Prozent BOP im April 2024 (Abbildung 12) war bereits ein Erfolg, jedoch war die häusliche Mundhygiene des Patienten weiterhin verbesserungswürdig. Der Patient wurde remotiviert und instruiert durch die ZMP.
Bei der dritten UPT im November 2024 war der API wieder auf 70 Prozent gestiegen und der BOP lag bei 13 Prozent (Abbildung 13). Beim Anfärben der Zähne wurde ein deutliches Putzdefizit ersichtlich (Abbildung 3, 4). Es wurde erneut die Putztechnik mit der elektrischen Zahnbürste überprüft und geübt. Zudem wurde der Patient befragt, welche Zahnpasta er aktuell nutze. Ihm wurde die Zahnpasta Meridol Parodont Expert empfohlen.
Auch die Interdentalraumreinigung wurde ein weiteres Mal geübt. Bei einer Kontrolle nach einer Woche (Abbildung 5) berichtete der Patient von einem trockenen Mund. Dabei wurde über seine Trinkgewohnheiten gesprochen und zusätzlich die Mundspülung Meridol Parodont Expert mit Hyaluronsäure eingesetzt. Außerdem erfolgte eine kurze Intervention durch eine Ernährungsberatung.
Infolge dieses Termins stieg die Adhärenz des Patienten merklich und nicht nur seine Mundgesundheit verbesserte sich. Auch sein Blutzuckerspiegel sank, der HbA1c-Wert lag zuletzt stabil bei 5,5. Der Blutdruck des Patienten hat sich unter der Einnahme von ACE-Hemmern stabilisiert. Derzeit putzt der Patient zweimal täglich mit der elektrischen Zahnbürste, er nutzt weiterhin die empfohlene Zahnpasta und Mundspülung und verwendet die Interdentalraumreinigung mindestens drei- bis viermal wöchentlich. Er ist sehr zufrieden mit seinem Mundgefühl und sieht selbst den Erfolg der UPT-Behandlung (Abbildung 6 bis 9, Befund vom 24.01.2025, Abbildung 14).
Fehlende Motivation des Patienten
Fazit: Oft wird nach abgeschlossener antiinfektiöser Therapie und erfolgter Mundhygieneunterweisung festgestellt, dass der Patient in seiner Adhärenz nicht motiviert werden konnte. Für zahnmedizinische Fachpersonen stellt sich dann die Frage, welche weiteren Tools in der zweijährigen UPT-Phase zur Verfügung stehen, um den Patienten doch noch zu einer erfolgreichen und zufriedenstellenden Zahnfleischgesundheit zu führen.
In diesem klinischen Fallbericht wurde gezeigt, welche entscheidende Rolle die antientzündliche Zahnpasta und Mundspülung bei der langfristigen Erfolgsplanung in der PAR-Therapie spielen kann. Der Patient wurde erfolgreich aus seinem entzündlichen Zustand geführt. Ebenfalls konnte eine sehr gute Adhärenz erreicht werden, um dem Patienten auch eine erfolgreiche Prognose für das Implantat an Zahn 15 zu ermöglichen.
Der Patient ist nun gewillt, seinen Anteil an seiner Mundgesundheit zu leisten. Er lässt sich gerne von der präventiv ausgerichteten Zahnarztpraxis begleiten und möchte weiterhin seine persönliche Mundhygiene mit der empfohlenen Zahnpasta und Mundspülung hochhalten.
Dentalhygienikerin Petra Natter, BA
Quelle: [1] Engebretson S, Kocher T. Evidence that periodontal treatment improves diabetes outcomes: a systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol. 2013 Apr;40 Suppl 14:S153–63. doi: 10.1111/jcpe.12084. PMID: 23627325.
Petra Natter
Petra Natter, BA, ist Dentalhygienikerin und bereits seit 1998 national und international als Referentin zu vielen Bereichen der zahnärztlichen Prophylaxe (u. a. Mundgeruch, Biofilmmanagement, Handinstrumente) tätig. Seit 2014 gibt sie Seminare zum Thema Prophylaxe in der Zahnarztpraxis.
Kontakt: www.paroprophylaxe.at